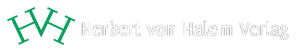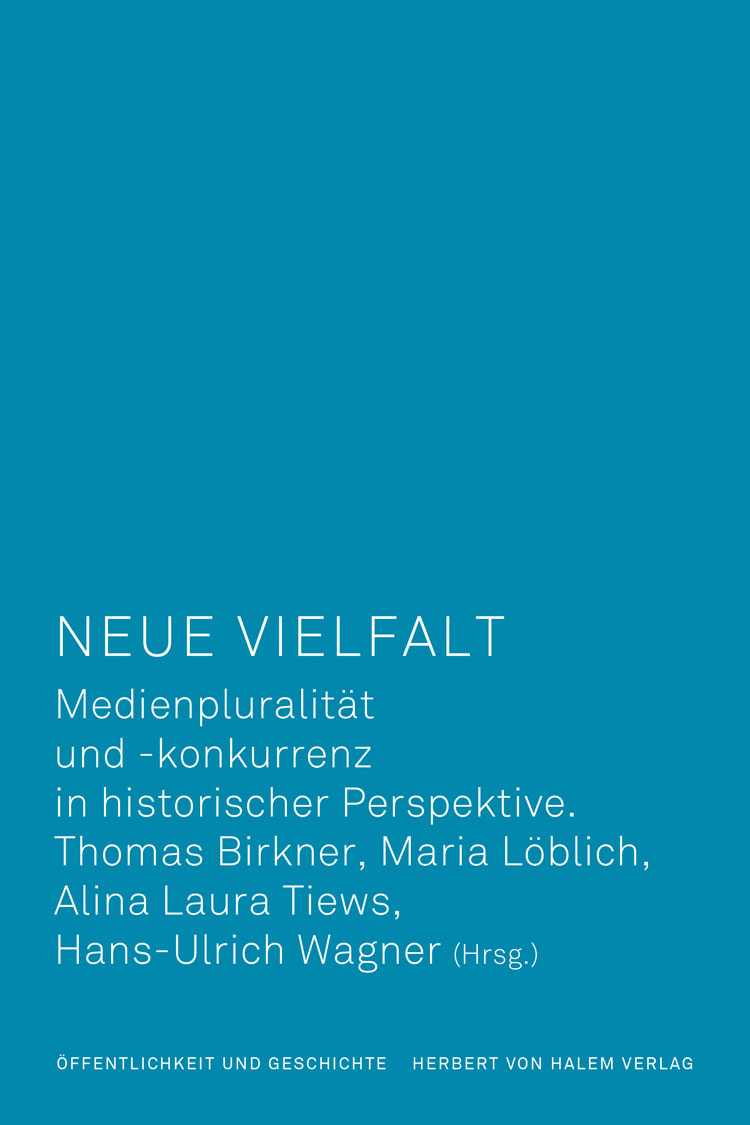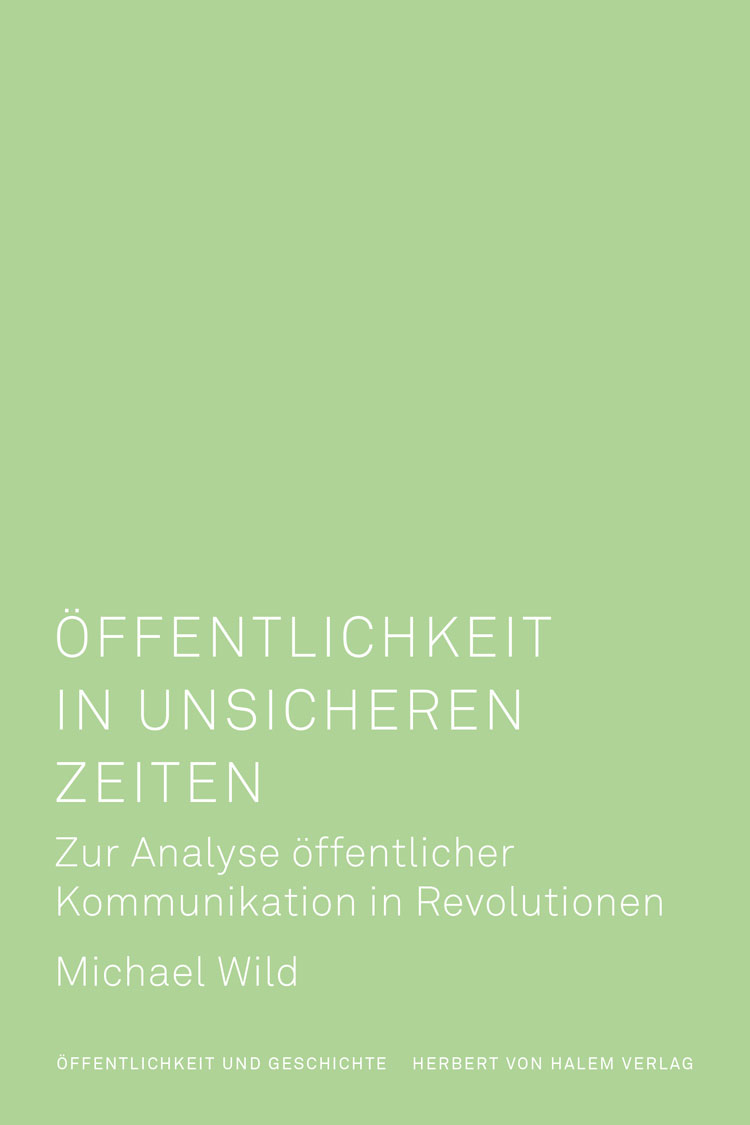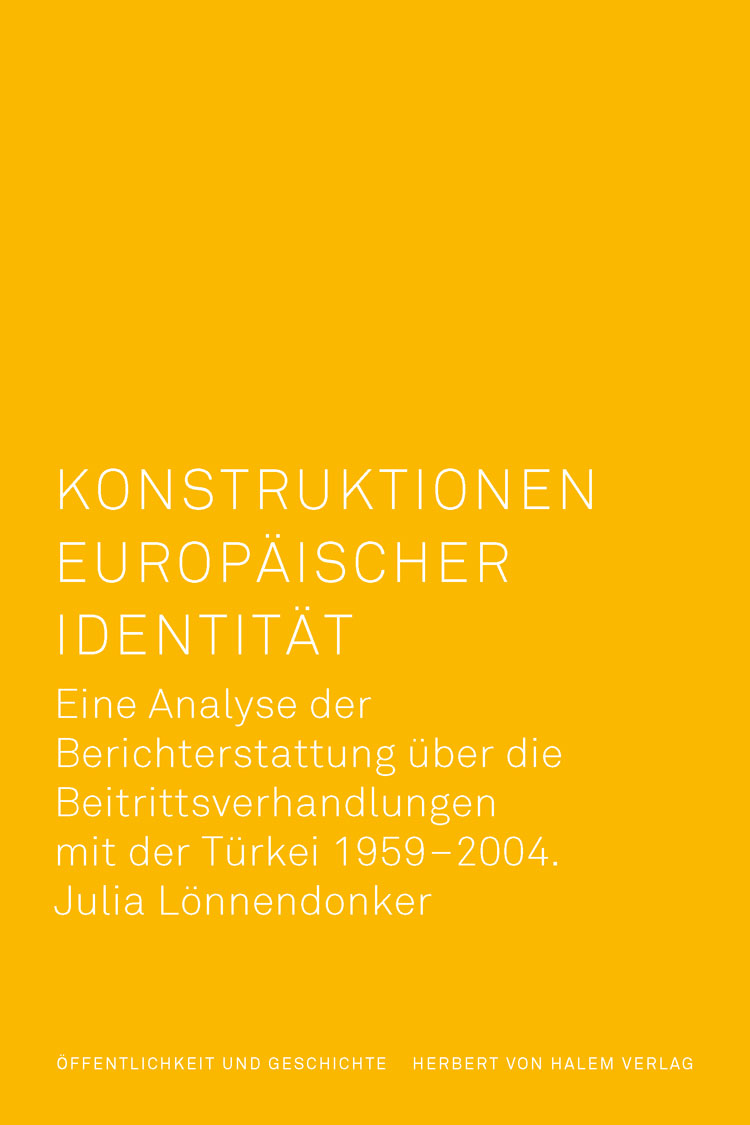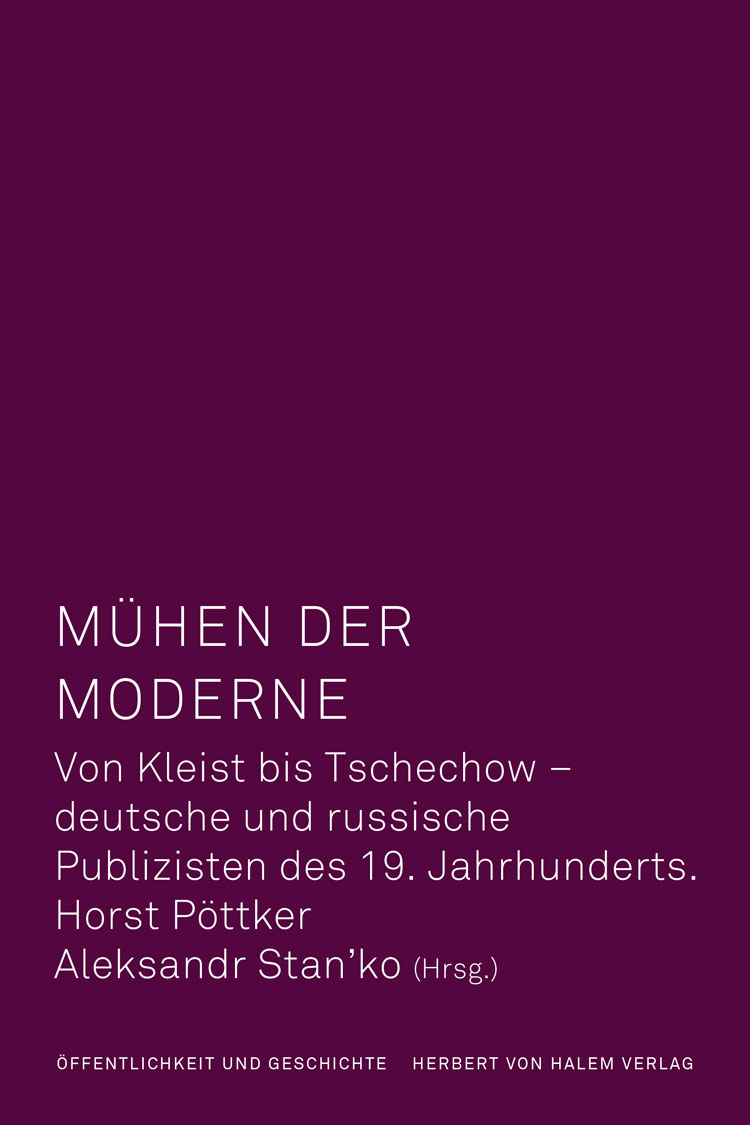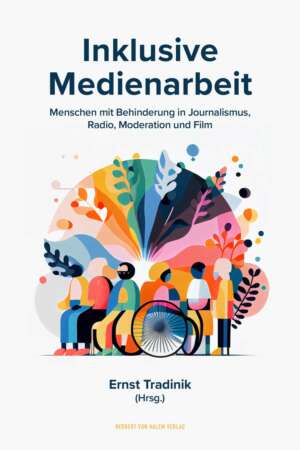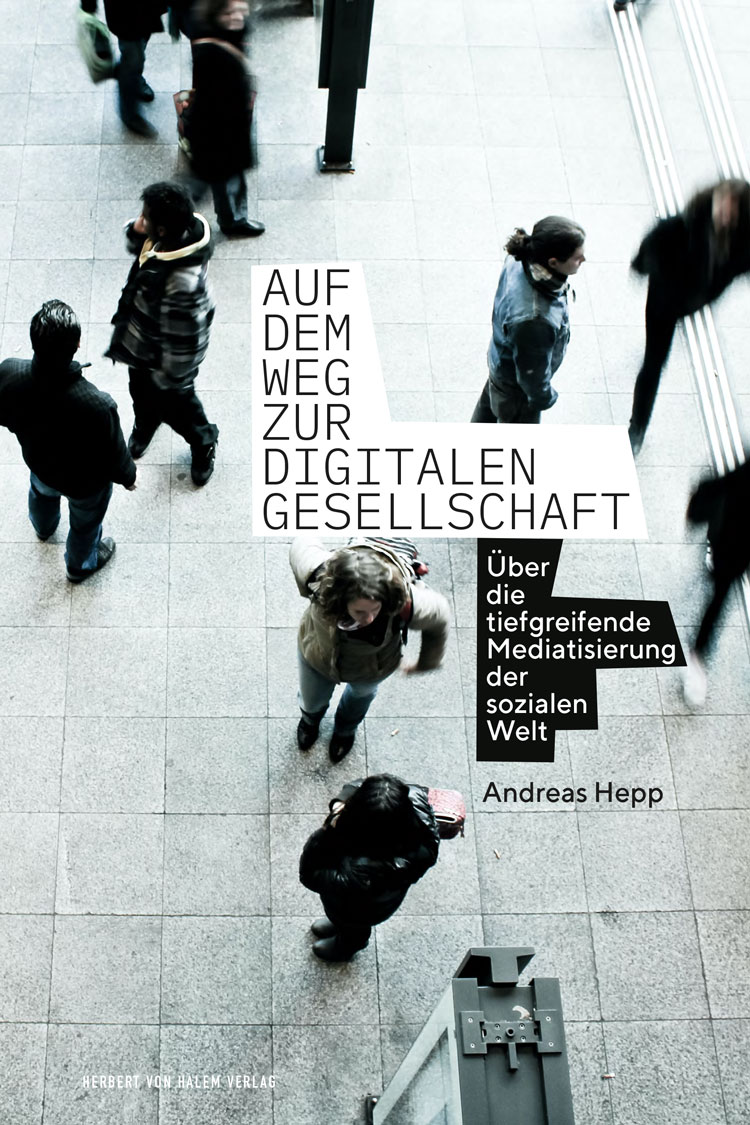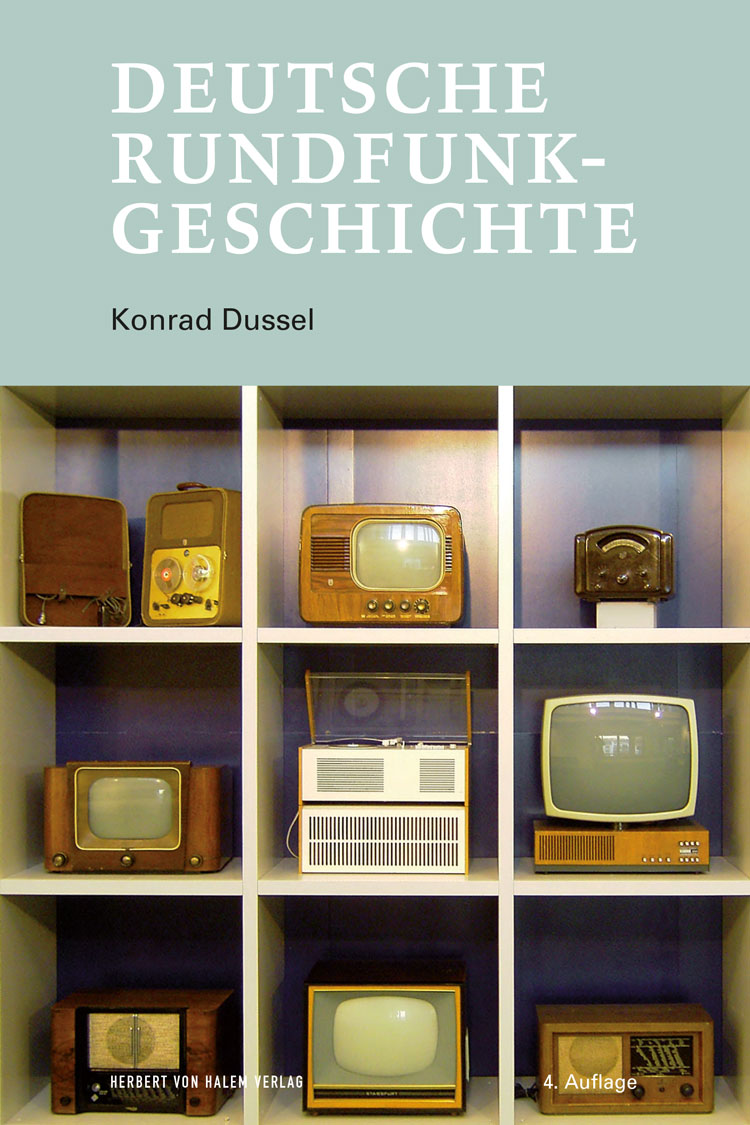Ausgehend von der Einführung des Dualen Rundfunksystems in Deutschland vor gut 30 Jahren werden im vorliegenden Tagungsband Medienpluralität und -konkurrenz aus historischer Perspektive betrachtet. Dabei werden unterschiedliche Facetten der Pluralisierung von Medien untersucht. Neben einer geschichtlichen Systematisierung werden zuerst Vorstufen von Medienpluralität und – konkurrenz etwa im Kaiserreich, im Radio der 1950er- und 1960er-Jahre und im DDR-Fernsehen analysiert. Anschließend stehen die handelnden Akteure jener Epoche im Mittelpunkt, in der private Rundfunksender in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen wurden. Schließlich werden die Auswirkungen auf andere Mediengattungen und auf die Mediennutzer ausführlich diskutiert.
Während die Formatierung des Radios wenig zur Vielfalt beigetragen hat, haben sich auch die gedruckten Nachrichten im Zeitverlauf verändert. Entsprechend entwickelt sich Nutzungsverhalten generationsspezifisch und Medienvielfalt bedeutet heute sowohl Bereicherung als auch Überforderung.
Thomas Birkner / Maria Löblich / Alina Laura Tiews / Hans-Ulrich Wagner
Einleitung
Patrick Merziger
"Zwei Nationen, die sich nie verstehen werden". Die Bildwelt in der populären illustrierten Presse im deutschen Kaiserreich 1900 - 1914
Sigrun Lehnert
Vom ›All in one‹ zur audiovisuellen Pluralität: Von der Kinowochenschau zu Fernsehsendungen mit Aktualitätsanspruch
Christoph Hilgert
Irreguläre Impulsgeber? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im asymmetrischen Wettbewerb um seine Hörer in den 1950er- und 1960er-Jahren
Susanne Vollberg
Das 2. Programm – Neue Vielfalt im Fernsehen der DDR?
Christian Herzog
Vom öffentlich-rechtlichen Oligopol zum dualen Rundfunksystem: Die Einführung des Privatfernsehens aus akteurszentrierter Perspektive
Anna-Lisa Neuenfeld
Das Ringen um die Macht. Peter Glotz und die SPD in den medienpolitischen Auseinandersetzungen der ›alten‹ Bundesrepublik
Thomas Birkner
"Rambos, Machos und Killer" – Helmut Schmidt und das Fernsehen
Jörg Hagenah
Über die Formatierung der Radiolandschaft durch die Einführung des dualen Rundfunksystems: Daten, Analysen und Forschungsperspektiven
Steffen Kolb
Vielfalt in deutschen Fernsehvollprogrammen
Nicole Gonser
Zwischen Bereicherung und Überforderung – Umgang mit Medienvielfalt am Beispiel der Privatrundfunkeinführung in der Bundesrepublik
Christian Schwarzenegger / Thorsten Naab
Neue Vielfalt und Mediengenerationen. Ein Beitrag zur historischen Mediennutzungsforschung?
Maria Karidi
Wie medienpolitische Entscheidungen die Nachrichten verändern: Eine Meta-Analyse zum Wandel des Massenmediensystems in Deutschland (1984 - 2014)
Jürgen Wilke
Pluralisierung von Medienangeboten. Historische Determinanten